Synthesizer Magazin: Fender Rhodes Chroma
By Der Moogulator, Klanganästhesist
![]() Der Chroma hatte wirklich eine harte Kindheit™ - eigentlich war die Firma ARP (zuvor auch „Tonus") der Vater des Chroma, doch ARP übernahm sich an diesem neuen Synthesizer mit neuem Konzept; auch das damals recht innovative Produkt Avatar (ein Katzendarm-Synthesizer) wurde nicht so recht angenommen (nur 300 Stück wurden gebaut). Danach ging es leider direkt in die große Pleitegeier-Aktion, und Fender Rhodes bzw. CBS wurde neuer Besitzer des großen und doch recht schweren Chroma-Schlachtschiffes. Er bietet übrigens auf seinem Gehäuse locker Platz für zwei Korg MS20 nebeneinander, und es gab auch bereits Expander-Versionen (ohne Tasten) des Chroma, im Jahr 1982 auch eher eine Vision mit zu weitem Blick. Es sollte noch ein Jahr bis zu den ersten Serien-MIDI-Synthesizern dauern, und für den Chroma ging es unter dem neuen Namen und der ARP-Technik in eine Branche, wo Fender Rhodes eher nicht so bekannt war. Eigentlich war er seiner Zeit weit voraus, denn alles war speicherbar, er hatte eine pseudomodulare Struktur und erinnert heute prinzipiell eher an den zwei Jahre später erscheinenden Oberheim Xpander als an die früheren ARPs (2600, Odyssey).
Der Chroma hatte wirklich eine harte Kindheit™ - eigentlich war die Firma ARP (zuvor auch „Tonus") der Vater des Chroma, doch ARP übernahm sich an diesem neuen Synthesizer mit neuem Konzept; auch das damals recht innovative Produkt Avatar (ein Katzendarm-Synthesizer) wurde nicht so recht angenommen (nur 300 Stück wurden gebaut). Danach ging es leider direkt in die große Pleitegeier-Aktion, und Fender Rhodes bzw. CBS wurde neuer Besitzer des großen und doch recht schweren Chroma-Schlachtschiffes. Er bietet übrigens auf seinem Gehäuse locker Platz für zwei Korg MS20 nebeneinander, und es gab auch bereits Expander-Versionen (ohne Tasten) des Chroma, im Jahr 1982 auch eher eine Vision mit zu weitem Blick. Es sollte noch ein Jahr bis zu den ersten Serien-MIDI-Synthesizern dauern, und für den Chroma ging es unter dem neuen Namen und der ARP-Technik in eine Branche, wo Fender Rhodes eher nicht so bekannt war. Eigentlich war er seiner Zeit weit voraus, denn alles war speicherbar, er hatte eine pseudomodulare Struktur und erinnert heute prinzipiell eher an den zwei Jahre später erscheinenden Oberheim Xpander als an die früheren ARPs (2600, Odyssey).

Die brennende Frage mach der MIDI-Nachrüstung...
Ja, es geht; es gab sogar mehrere Anbieter. Hier in Deutschland waren es EES und Jellinghaus, heute muss man dafür das CC+-Interface aus Kanada ordern, bekommt aber eine feine aktuelle MIDI-Implementation und SysEx-Dump-Funktionalität „von heute" mit eingebaut. Vom Chroma gibt es etwa 3000 Stück. Das ist relativ viel für ein exklusives Instrument, aber weit weg von einem Erfolgskonzept. Das lässt einen DX7 oder einen C64 nur sehr müde grinsen.
Chroma Kino – Das Konzept
Etwas ungewöhnlich, jedoch durchaus zu der Klientel passend, die man damais anziehen wollte: Art und Erscheinung zeigen deutlich auf den „Player", die Zawinule unter uns, die Rhodes-Spieler - also die, die gerne Tasten spielen. Indizien dafür sind die halb-gewichtete Tastatur und die Erscheinung des Gehäuses. Für eine Firma wie Rhodes dürfte das damals noch als „portabel" durchgegangen sein, denn die Tastatur hat knapp fünf Oktaven Umfang. Das Gehäuse ist schon recht wuchtig und schwer. Man verzichtete auf einen Teil der Oberfläche für Regler oder Knöpfe zugunsten einer Stellfläche, was ebenfalls sehr der Rhodes-Denkweise entsprechen dürfte. Preislich dürfte das einfach Geld gespart haben. Schließlich hat auch Roland mit den Mitt-80er-Analogen gezeigt, wie man sparen konnte: Knöpfe und Synthesizer getrennt verkaufen, da man diese eventuell auch eher dem Programmierer zuteilte und der Rest brav Sounds kaufen sollte? Nicht ganz, es war einfach nur billiger als mit Knöpfen. So einfach und so banal ist die Wahrheit: Das sparte immense Kosten bei der Produktion, und die Programmer kauften nur die betuchteren Musiker – heute sind sie oft teuer als die Synthesizer selber. Zurück zum Chroma: Im Inneren sieht es gar nicht so konservativ aus, wie es scheint. Leider ist bis heute der „PIayer-Typ" immer noch relativ selten auch leidenschaftlicher Synthese-Ausnutzer, was auch an der (sehr gelungenen) Preset-Klangausstattung erkennbar ist (es gab eine Menge Sounds dazu, wenn man MIDI nachrüstete etc.). Diese Klischees muss man natürlich nicht füttern, jedoch ist der Chroma grundlegend heute ein reines Studioinstrument und braucht Zeit, da seine Bedienung ausschließlich über Folientaster und einem Schieberegler nach dem bekannten Prinzip „Parameternummer antippen und mit Regler Wert einstellen" funktioniert. Das Konzept hat einiges mit dem Korg Poly 800/Poly 61 oder heute dem Microkorg gemeinsam, wenn Letzterer auch immerhin eine Zeile Regler hat. Was man neben dem Folientasten-Klick noch wissen muss, ist die Zuordnung der Modulationsquellen und Verschaltungen. Sie werden nämlich nur als Zahlen angezeigt und sagen damit aus, welche Quelle oder Ziel gewählt ist – intuitiv ist das sicher nicht.
Der Chroma ist mit 16 OSC-Filter-Amp-Strängen versehen, die paarweise verkoppelt werden. Ein-oszillatorige Patches sind somit 16-stimmig. Wie zur erwarten, gibt es auch acht- und vierstimmige Verschaltungen. Jedem Strang sind ein LFO, zwei Hüllkurven, ein Verstärker/VCA und natürlich ein Filter zugewiesen. Sie alle sind komplett analog. Jeder Strang kann unabhängig Glissando oder Portamento mit dem zugehörigen VCO erzeugen. Interessant ist das bei Modellen mit mehreren VCOs und unterschiedlichen Portamento-Zeiten. Die Wellenformen sind variabler Puls, Sägezahn oder Rauschen in weiß oder rosa.
Pudelskerne im Chroma finden sich bei der Verkopplung und Verkettung der Stränge und der genannten „Module" in diesem Strang. Entscheiden kann man sich für serielle, parallele oder variabel mischbare Verschaltung der Stränge gegenseitig mit Ring- modulation, (Oszillator)-Sync oder Filter-FM in klassischer Weise. Die Verstärker sind normalerweise nach dem Filter geschaltet, jedoch nicht so im „variablen" Modus.
Die Filter sind allesamt 12 dB pro Oktave und als Tief- oder Hochpass schaltbar. So ergeben sich bis zu 24 dB/Okt. Filterung pro Paar mit Bandpass oder Notch-Funktion oder als Doppel-Tiefpass. Die Resonanz ist in (nur) acht Stufen regelbar, sie reicht bis kurz vor die Selbstoszillation und ermöglicht auch „zapp"-sounds im Electro/Kraftwerk- Stil. Die LFOs sind vergleichsweise sehr langsam (12 Hertz ist Maximum), jedoch gibt es sehr vielfältige Wellenformen und Muster (neben Grundwellen sind das diverse Treppenstufen-Varianten und Sample&Hold). Beim Chroma heißt der LFO Sweep Generator Die Geschwindigkeit ist modulierbar. Es gibt für viele Parameter eine Liste von Modulationsquellen, die leider nur als Nummern im Display auftaucht.
Entweder muss man sich die 15 Einträge merken oder aufschreiben. Lautstärken haben zwei Modulationsquellen, der Filter-Cutoff (Eckfrequenz) hat sogar drei Modulationsquellen. Die Resonanz ist nicht modulierbar, sehr wohl jedoch die LFO-Geschwindigkeiten und Auslenkung (Modulationsintensitäten). Auch die Hüllkurven- segmente Attack- und Decay-zeit sind modulierbar. Die Tastatur verfügt über Anschlagdynamik und Aftertouch, so dass die Modulations-Möglichkeiten nicht unattraktiv sind. Die Hüllkurven haben keine Sustain- Phase, sie sind als DADR- und ADR-Struktur aufgebaut. Sie sind nicht vorgepatcht, also frei zu verwenden, und reichen für kurze melodische Sequencer-„Blips" aus, sind aber sicher nicht als schnell zu bezeichnen. Die Auflösungen der Klang-Parameter sind meist 64-stufig. Die Eckfrequenz und Tonhöhe haben sogar bipolare (pos./neg.) Modulation mit 128 Stufen. Die Lautstärke hingegen kommt mit 16 Stufen aus. Die Hüllkurven haben 32 Stufen zu bieten.
Die Modulationen durch Touch und die Modulation kann leider nur „eingeschaltet" und durch die Anwahl in ihrer Intensität grob variiert werden - Anschlagsdynamik ist damit nur da oder nicht da.
Durch die unabhängigen Glides pro Oszillator lassen sich übrigens Sync-Effekte durch Spielen weit entfernter Noten erzielen. Da die beiden Oszillatoren unterschiedlich schnell bei der Tonhöhe der zuletzt gespielten Note angekommen sind und sich bei Glissando dazu noch in Stufen zum aktuellen Wert bewegen. Ergo: Weit auseinander liegende Noten erzeugen auf Wunsch „schneidenden" Sound. Die LFOs haben verschiedene Trigger-Modi, was durchaus bemerkenswert ist für die Zeit.
Funktionäre
Als abschließendes Wort zur Technik noch einen Blick auf den "Keyboard Algorithm". Darunter versteckt sich ein Akkord-Speicher, der Arpeggiator oder vetschiedene Tastenzuweisungen für die Reihenfolge der Stimmen beim Spiel (Mono, Poly, letzte / höchste Note Priority etc.).
Der Arpeggiator bietet auch einen Random-Mode, um jede angeschlagene Note zu spielen, wenn der Zufall das so will. Die Sequencer-Betriebsart ist eigentlich eher ein Arpeggiator, der sich die Reihenfolge der Noten im Arpeggio merkt und dann in der gleichen Reihenfolge wie beim Einspielen als Arpeggio wiedergibt - wie gespielt. Netterweise wird die Dynamik der Einzeltöne auch berücksichtigt. Ungewöhnlich sind auch die drei Equalizer- Regler (Bass, Mitten, Höhen). Wie notwendig das ist, überlasse ich mal der ganz gemeinen Allgemeinheit. Rein äußerlich gibt es vier Einzelausgänge zu bewundern, dazu noch die Möglichkeit, verschiedene Pegel an verschiedene Ausgänge zu geben, sowie XLR-Ausgänge. Luxus pur.
Zum Lieferumfang gehört ein Monster von Doppel-Fußpedal und dazu ein Schweller. Das Handbuch auf Deutsch ist etwas seltsam, es erklärt aber die Verschaltungsmodi und macht klar, dass nicht der Gesamtstrang für eine Ringmodulation herangezogen wird, sondern der Ringmodulator stets klassisch verdrahtet ist, also durch die beiden VCOs der jeweiligen Stränge. Es wird aber schon mal mit semi-geschickt formulierten Sätzen Einfaches von hinten durch die Brust ins Auge erklärt. Wer etwas Synthesizer-Erfahrung hat, kommt aber ohne die Anleitung aus, softern die Modulationsequellen und Verschaltungen bekannt sind. Die sollte man sich ausgedruckt auf das dicke Gehäuse kleben. Mein Tipp, wenn mal keine Anleitung dabei ist: In ein Editor-programm (Sounddiver) schauen. Natürlich sind Editoren nicht immer gleich gut einsetzbar, denn dies sind abhängig von den Nachrüstungen und müssen nicht identisch sein be der genauen Implementation von SysEx-Meldungen.

Der Apfel fällt nicht weit vom Verzeichnisbaum
Chroma mit Computeranschluss hieß Anno 1982 nicht MIDI, und den Atari ST oder Macs gab es auch noch nicht. Ergo: Apple II/IIe heißt das Wunderwerk zur Steuerung von einfach allem, für den gab es sogar Editorsoftware, und die Schnittstelle ist vom Typ RS232. Das war die zu diesen Zeiten Üblischste, zumindest neben diversen Userports (die Sinclairs, der C64/ der Apple ][). Sie wurde von Bastelgeeks allerorten gern für dieserart Arbeit genutzt und war doch immer noch mit dem Reiz von DIY (do it yourself) vegunden. Hersteller für MIDI-Interfaces waren Syntech, Chroma Cult, KMX, EES Wieschiolek und Kenton, sowie das JL Cooper ChromaFace. Davon ist nur noch das oben schon erwähnte CPU Plus (CC+) von David Clarke [21030085++] und Sandro Sfregola [21010294] übrig geblieben, und das ist auch das technisch neueste. Es ist zudem auch ein tieferer Eingriff in den Chroma, aber dafür mit dem Syntech-Interface kompatibel. Neben dem RS232-Anschluss auf der Chroma-Rückseite gibt es einen optionalen Anshlussplatz, der sich für MIDI prima missbrauchen lässt. Das Syntech-Interface selbst ist übrigens auch noch erhältlich, jedoch von einem ehemaligen Mitarbeiter namens Ken Ypparila [21030229].
Wer es so weit gebracht hat, muss nur noch eine Software finden, die damit etwas anfangen kann. Wer noch einen Apple II hat, kann ChromaGraph (LaBach/Kevin Laubach [21030154]) oder das Chroma Music System nutzen, es ist jedoch eher ein Sequencer-Programm als ein Editor. Für die anderen und moderneren Menschen ist Sounddiver ein Strohhalm zum Umklammern, es ist nämlich mit einer Adaption für den Chroma ausgestattet – nur hat Apple seine Entwicklung leider für unzeitgemäß erklärt. Es gibt auch eine Mixer-Map für Cubase. Ansonsten hat der Chroma ein wundervolles Kassetten-Interface (wer lacht denn da jetzt?).
Wer den „Hartbitrock" der 80er im Modem-Sound-Remix wieder hören will, kann zumindest seine Patches auf diese ur-alte Weise sichern. Man muss ja keinen alten Monorecorder dafür nutzen. Es kann auch immer noch passieren, dass man sich heute was Neues einfallen lassen muss, wenn keine der genannten Lösungen im Hause zu finden ist. Theoretisch gehen auch alle Controller, die SysEx erzeugen können (Mackie C4, Novation Remote SL, etc.) als Editoren durch. Hier ist noch Nachholbedarf.
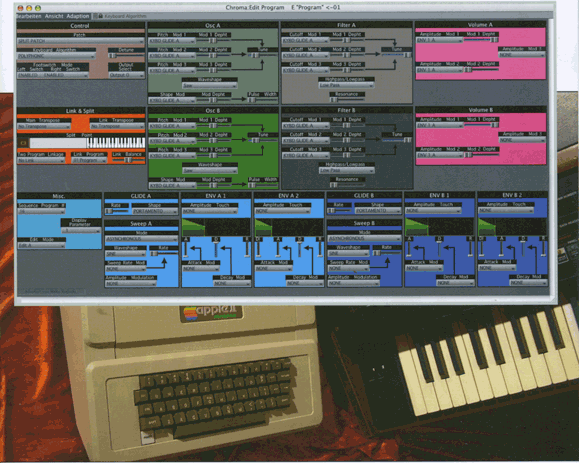
Input Output Kaputt?
Geht er noch? Wer sich die Frage stellt, schaut ihm erstmal in die Augen - im Display sollte nach dem Einschalten keine Fehlermeldung erscheinen, wenn doch, sollten all Voice-Cards innen einmal rausund wider reingesteckt werden und eventuell auch mal mit einem Radiergummi die Kontakte vorsichtig ent-oxidiert werden.
Funktioniert dann noch etwas nicht, sollte man zuerst bei der Stromversorgung suchen. Nicht immer ist gleich ein Voice-Board wirklich kaputt. Wer den Chroma reparieren, checken oder einfach nur bis an die Zähne modernisieren will, der kann Kondensatoren und Widerstände und auch Trimmpotis ersetzen und auf der wirklich hervorragenden Site Rhodeschroma.com sehr gute Tipps dazu bekommen. Nicht selten sind es nur Böse Netzteile, die ursprünglich für 100V/60Hz gebaut wurden, nur unterdimensioniert. Das gilt eher generell für Technik, die in den USA entwickelt und/oder gebaut wurde (Autor schielt zum Oberheim Matrix 12, um sich danach wider demo Chroma zuzuwenden).
Monster im Monsterpelz oder Synthi und Chroma sind in der Minderheit
Wie zu Beginn geschildert, ist der Chroma ein ziemliches Monster an Gewicht und etwas unspontan bei der Bedienung. Auch wenn nach zweimaligem Drücken auf dieselbe Folientaste die zuvor genutzte Funktion aufgerufen wird, und auch wenn es einen Mechanismus zum Editieren von zwei identischen Parametern in unterschiedlichen VCO-VCF-VCA-Strängen gibt. Es wird einem etwas geholfen, das ersetzt aber kein richtiges Reglerset. Einige Veränderungen werden mit einem Schalt-geräusch im Inneren des Chroma quittiert, fast wie ein Relaisklackern. Es ist sicher immer etwas zeitaufwendiger, wenn man sich nach Art des Korg Poly 800 durch die Parameter einzeln durchhangeln muss und bei den Modulationsquellen immer wieder nachsehen muss, welche Zahl mit welcher Modulationsquelle oder bedeutung versehen ist. Allerdings muss man den Parameter nicht als Zahl anwählen, sondern per Taster, und verändert dann seinen Wert. Unverkennbar ist aber die Mühe etwas wert, denn der Chroma klingt wirklich extrem gut. Er erinnert nicht nur an den ARP-Sound, er IST nun mal ein echter ARP. Ein Jammer, dass es nicht noch eine Weile länger ARP-Instrumente gab, sie wären sicherlich heute sehr begehrt. Klanglich gibt es manchmal bei resonanten Sounds Momente, die an den Xpander erinnern in Qualität und Teuerheit™.
Man könnte im abgespeckten Chroma Polaris eine Alternative finden. Er ist leichter und intuitiver zu bedienen, jedoch bietet er nicht ganz so viel an Möglichkeiten an. Wie schon gesagt: Der Sound ist wirklich sehr gut mit den ARP Synthesizern aus alten Tagen vergleichbar, jedoch polyphon. Überzeugender und auch voller, tiefer, inspirierender Klang erwartet den Folien-tastendrücker. Die Filter und Osczillatoren klingen sehr voluminös und breit, jedoch nicht so stark gefärbt wie die eines Moog, sondern etwas neutraler und stets sehr „teuer" - hochwertig.
Mit Sicherheit kann der Chroma fast alle VAs heutiger Bauweise mit nur einem Oszillator aus dem Weg blasen. Eine besondere Kunst muss man dazu vielleicht nicht beherrschen, wenn EQ und Filter mit Resonanz zum Einsatz kommt, zeigt sich kaum eine Ausdünnung – auch nicht bei höchster Resonanz, jedoch lässt sich mit einer HPF/LPF Filter-Kombination und heruntergestimmtem Hochpass wie schon beim MS20 ein weites und irgendwie spannend-waberndes Fundament legen. Die lebendigen Modulationsmuster des/der LFOs bringen im Zweifel genug Bewegung hinein. Die Filter-FM klingt ebenso wunderbar „teuer" und nicht einfach nur dünn und harmlos. Wenn es zu Verzerrungen kommt, dann mit voller Resonanz, und dabei sehr angenehm musikalisch. Der Chroma ist also ein Wolf im Wolfspelz. Wenn wir wirklich etwas jammern wollen, dann über die fehlenden Regler. Es gibt sogar eine Controllerbox, die ein Chroma-DIY-Freak extra gebaut hat, da der Chroma mittels MIDI-Interface auch über SysEx-Befehle steuerbar wird. Generell kann man dies auch über die RS232-Schnittstelle tun, jedoch ist die Kommunikation mit dem Chroma zumindest teilweise zu entschlüsseln. Auch daran haben sich offenbar schon andere Nutzer versucht, weshalb die schon genannte Website auch hierzu zumindest hilfreiche Ideen hat. Unter dem Namen Windows Interface/Window Chroma Server finden sich einige Versuche für PCs. Somit steht Experimenten mit dem PC im Bunde mit dem Chroma nicht viel im Wege.

Endgelaber, Zusammenfassung, Fassung bewahren
Bleibt nur noch zu sagen, dass der Besitz des Chroma heute sicher etwas ist, was man sich mit Zeit, Geld und Geduld beim Kauf und einem größeren Platzbedarf im Sutio erschleichen muss. Zur Bedienung sag ich dabei nichts mehr, die ist eben so, wie sie ist, und vielleicht wird der Chroma dadurch vielleicht preislich nicht so explodieren wie die Herren Jupiter oder ARP 2600. Der Klang ist dafür garantiert gut und teuer. Wem die Standard-Struktur noch zu wenig komplex ist, der kann Klänge auch splitten oder als Dual-Sound zusammenfassen, jedoch landet man dann bei vier Stimmen, bzw. wenn der zweite Klang monophon ist, bei sieben Stimmen. Das universelle Multitimbral-Monsterschiff ist er damit natürlich nicht, jedoch ein großer schritt für die ARP-Ingenieure und den glücklichen Besitzer und sein nächstes Album.
Erste Versionen des Chroma hatten sogar noch ARP-Beschriftung auf den Platinen. Der Chroma enthält CEM(Curtis)-Chips. Es sind acht CEM3350 Dual VCFs und acht (bzw. in einigen Versionen sogar neun) CEM3360 Dual VCAs. Natürlich werden die CEMs nicht mehr hergestellt, und ihr Hersteller ist leider bereits tot. Die bleichen Filterchips wurden auch im „Beinahe-Moog" Crumar Spirit und im seltenen niederländischen Synton Syrinx eingesetzt. Somit kann man sagen: Exklusiv ist der Chroma auf jeden Fall. Das Display erinnert an frühe Taschenrechner und ist ziemlich klein, wesentlich größer ist die Anzeige für den aktuell gewählten Sound.
Warum diese Info? Weil man sich einen Chroma wirklich nur kaufen sollte, wenn man ihn haben will und seinen Sound mag. Es ist nicht schön, wenn man nach solchen Teilen suchen muss, jedoch kann er auch noch eine Weile fröhlich weiter funktionieren. Enttäuscht sein wird man nicht, jedoch sind die nicht sonderlich schnellen Hüllkurven und die exorbitant langsamen LFOs in heutiger Musik vielleicht etwas anders zu bewerten als damals. Langweilig klingt er trotzdem nie. Er dürfte, neben dem schon erwähnten Oberheim Xpander, klanglich noch lange zu den besten mit CEMs zusammengehaltenen Syntehsizern gehören.
Ich höre nicht auf damit: Er klingt einfach gut, teilweise besser als andere mit ähnlichen Bauelementen. Auch hier merkt man: Es kommt auch bei Standard-Bauteilen immens darauf an, wie CEMs verscheltet sind, damit sie gut klingen können.

Der Chroma ist nicht der einzige Synthesizer mit Software-LFOs und Hüllkurven. Dies nur als generelle Information, da gern verallgemeinert wird und nachher überall zu lesen sein wird, dass Software-hüllkurven und -LFOs nichts taugen. Das stimmt natürlich nicht. Den Chroma unterschätzen kann man doch recht schnell. Das Argument Number eins für einen Chroma dürfte Mehrstimmigkeit und der warme und hochwertige Klang sein. Im Gegensatz zu einigen anderen ARP Synthesizern ist auch die Resonanz weniger ausdünnend, so gesehen ist er mehr 2600 als „Odyssey" — auch wenn der Vergleich strukturell hinkt. Die Messlatte für den Klang ist hoch, insbesondere die Software-Generation dürfte diese Art von Klang kaum noch kennen.
Der Chroma gehört eher zu den geheimeren Tipps der Synthesizerfreaks als zu den Klassikern, die jeder Technojünger aufsagen kann. Generell kann ich mir vorstellen, dass der Chroma im Preis in ähnliche Höhen steigen könnte wie ein Jupiter 8, den heute jeder kennt.
Software-Alternativen gibt es keine, man kann die ARP 2600 und Odyssey-Emulationen als Alternativproduct in Betracht ziehen, noch besser vielleicht die Creamware/Soniccore-Variationen oder den Plugiator von inDSP/Use-Audio, der ebenfalls auf ehemaliger Creamware-Technik basiert. Identisch klingt da aber nichts - der Chroma scheint mir da klanglich noch einiges besser zu machen, insbesondere feine Filter-FM-Sounds wirken organischer und runder. Die Stärken des Chroma liegen in spannenden Flächen, Leadsounds und Melodie-Klängen. Bässe sind auch kein Problem für ihn. Wie beim Kollegen Xpander würde ich ihn für wertigen Synthpop als sehr gute Wahl sehen. Die Form und Oberfläche fällt etwas ab und ist vielleicht nicht so „kultig", aber wer wirklich wert auf Sounds legt und nicht zu sehr auf Gearporn-Aspekte pocht, erreicht mit dem Chroma prima Sounds. Wer Boards-of-Canada-Melodien mag, dürfte übrigens genauso gut eine neue Liebe finden und sogar noch ein bisschen an Qualität hinzugewinnen.
Ist der Chroma der Messias? Antwort: So halb. Man nehme ein nicht ganz perfektes Editor-Design zugunsten eines hervorragenden Klanges in Kauf. Dazu bekommt man einen Synthesizer, der seiner Zeit technisch weit voraus war. Er ist sicher kein Modularsystem — er ist weit weg davon, wenn man heutige Maßstäbe ansetzt — er tut aber seinen Job extrem gut. Meines Erachtens ist er eigentlich einem Schwergewicht à la Prophet 5 in diesem Punkt überlegen. Vermutlich wird man das heftigst ausdiskutieren müssen. Dafür gibt es ja das Forum.
Dank an Klaus Fels für die Leihgabe des Chroma.
Weblinks
- CC+ MIDI Interface und sehr informatiive Site inkl. Schaltpläne und Tipps, wo man unbedingt schauen sollte: www.rhodeschroma.com
- Zum Chroma und Chroma Polaris sind auch bluesynths.com, das Forum und die Synthesizer-Datenbank Sequencer.de zur Auskunft bereit.
- Welche Chips sind in welchem Synthesizer? Antwort im SynthWiki von Sequencer.de: Chips in Synthesizers
Audio
- demo.mp3, 0:28 (696K)
- FMableep.mp3, 1:27 (2.5MB)
- reso.mp3, 0:31 (728K)
- synthpop.mp3, 1:21 (1.9MB)


